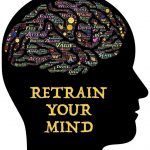10. Geburtstag Tagesklinik Bipolar: Lebensstil als Chance erkennen!
10. Geburtstag Tagesklinik Bipolar: Lebensstil als Chance erkennen!
Der 10. Geburtstag der Tagesklinik Bipolar im Vivantes Humboldtklinikum in Berlin-Reinickendorf durfte ich einen Vortrag zum Thema der Tagung halten. Darüber habe ich mich gefreut, auch, weil ich von meiner Tochter weiß, dass in der Krankenhaus und der Tagesklinik nicht nur gepredigt wird, sondern wirklich versucht wird, bipolar Erkrankten auf ihrem Weg in ein gutes Leben trotz und mit der Krankheit zu unterstützen. Schön ist dort auch zu sehen, dass gemischte Teams aus Ärzt*innen, Therapeut*innen und Peer Berater*innen dort arbeiten und auch diesen Geburtstag ausgerichtet hatten. Frau Professor Krüger, Chefärztin des Zentrums für Frauengesundheit im Vivantes Klinikum hielt eine herrliche Laudatio auf Prof. Peter Bräunig, der wohl gegen erhebliche Widerstände der Fachkolleg*innen diese Tagesklinik vor 10 Jahren gegründet hat und überhaupt das Thema der bipolaren Erkrankungen in den Fokus gerückt hat. Nachmittags gab es dann Workshops, in denen die Wünsche aller drei Akteure im psychiatrischen Trialog aneinander diskutiert wurden. Die Tagung kann als Erfolg verbucht werden: Es war gepackt voll, die Türen nach außen mussten in dem großen Saal geöffnet werden, damit auch die Menschen, die keinen Stuhl oder einen Sitzplatz auf dem Boden mehr ergattert hatten, dennoch zuhören konnten. Das allein ist schon ei Erfolg: Wo erlebt man es denn sonst, dass psychisch Erkrankte in Scharen in eine Psychiatrie strömen? -:)
- Neu lernen
- Stress vermeiden
- Wirklich zuhören
- Angst überwinden
10. Geburtstag Tagesklinik Bipolar: Lebensstil als Chance erkennen!
Mein eigener Vortrag wurde freundlich angenommen, es wurden mir viele schöne Dinge gesagt. Das hat mich sehr gefreut und meinen Lebensmut sehr gehoben! Hier nun der Vortrag für Menschen, die vielleicht noch mal nachlesen wollen oder auch auf diese Weise am 10. Geburtstag teilhaben wollen:
Janine Berg-Peer: Lebensstil als Chance erkennen
Es ist leicht zu erkennen, dass ein guter und gesunder Lebensstil gesund ist. Dafür bin ich allerdings keine Expertin. Deutlich weniger leicht ist es, diese Erkenntnis auch umzusetzen. Dafür bin ich Expertin. Dennoch halte ich das Konzept der Lebensstilveränderung für Betroffene für sehr wichtig. Nicht nur, weil es mir einleuchtet, dass es sinnvoll und gut ist, sondern auch, weil damit die Betroffenen wieder ein Stück mehr Autonomie, mehr Kontrolle über ihr Leben erlangen können. Sie können selbst etwas tun, sie sind nicht einfach ihren Gefühlsschwankungen ausgeliefert oder abhängig von Ärzten oder Medikamenten.
 Hier setzt das Konzept der Tagesklinik an: Betroffene werden nach der akuten Krise für sechs Wochen dabei unterstützt, einen guten Lebensstil für sich zu finden, das heißt zu lernen, wie kann ich mit und trotz meiner Erkrankung en gutes Leben führen. Ich habe einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise der Tagesklinik und der dortigen Ärzte und Therapeuten bekommen: Meine Tochter war gerade im Sommer hier auf einer Station und hat sich danach für sechs Wochen Tagesklinik entschieden. Und dass, obwohl sie keine guten Erfahrungen in einer anderen Tagesklinik hatte und sie morgens jeden Tag einen anderthalbstündigen Weg auf sich nehmen musste. Diese Entscheidung hatte sicher etwas mit der Haltung der Profis hier zu tun. Sie hat sogar Ergotherapie mitgemacht: Henriette, als erklärte Ergotherapie-Feindin Oh-Ton: „Mir hat noch niemand erklären können, wieso Seidenmalerei gegen eine Manie helfen soll!“. Als ich sie fragte, warum sie denn nun Ergotherapie mitmache, meinte sie, der Ergotherapeut wäre nicht nur witzig, sondern zum ersten Mal hätte ihr jemand erklärt, warum Ergotherapie helfen könne.
Hier setzt das Konzept der Tagesklinik an: Betroffene werden nach der akuten Krise für sechs Wochen dabei unterstützt, einen guten Lebensstil für sich zu finden, das heißt zu lernen, wie kann ich mit und trotz meiner Erkrankung en gutes Leben führen. Ich habe einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise der Tagesklinik und der dortigen Ärzte und Therapeuten bekommen: Meine Tochter war gerade im Sommer hier auf einer Station und hat sich danach für sechs Wochen Tagesklinik entschieden. Und dass, obwohl sie keine guten Erfahrungen in einer anderen Tagesklinik hatte und sie morgens jeden Tag einen anderthalbstündigen Weg auf sich nehmen musste. Diese Entscheidung hatte sicher etwas mit der Haltung der Profis hier zu tun. Sie hat sogar Ergotherapie mitgemacht: Henriette, als erklärte Ergotherapie-Feindin Oh-Ton: „Mir hat noch niemand erklären können, wieso Seidenmalerei gegen eine Manie helfen soll!“. Als ich sie fragte, warum sie denn nun Ergotherapie mitmache, meinte sie, der Ergotherapeut wäre nicht nur witzig, sondern zum ersten Mal hätte ihr jemand erklärt, warum Ergotherapie helfen könne.
- Ich mache mir Sorgen
- Lass mich in Ruh
- Wo sitzt die Krankheit?
- Ich verstehe gar nichts
- Was soll ich bloss tun?
Genau dieses Erklären ist so wichtig: Kein Betroffener weiß sofort, welche Verhaltensweisen gut für ihn sind und welche ihn zu sehr stressen könnten. Aber auch wenn jemand gesagt bekommt, was für ihn gut ist, ändert niemand seinen Lebensstil, wenn er nicht versteht, warum das für ihn gut ist. Eine Lebensstiländerung oder –anpassung setzt also vier Schritte voraus:
1. Kognitiv verstehen, dass eine Veränderung gut ist: Daher muss immer der erste Schritt zu einer Verhaltensänderung die Aufklärung sein: Wir müssen verstehen, in welcher Situation ist meine Erkrankung aufgetreten, wann hat sich immer eine neue Krise angebahnt? Daher beginnt es auch in der Tagesklinik mit einer Rückschau auf das eigene Leben: In welchen Situationen ging es mir gut bzw. nicht gut? Wann fühle ich mich überfordert? Was tut mir gut? Wie ist meine familiäres Umfeld, was ist daran günstig, was weniger günstig?
 2. Emotional annehmen, dass eine Verhaltensänderung gut ist: Aber auch wenn ich verstanden habe, was nicht gut für mich ist, fällt es nicht unbedingt leicht, bestimmte Dinge zu lassen oder Dinge zu tun, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Erst wenn ich das auch emotional akzeptiert habe, kann ich mit den Veränderungen beginnen. Aber auch dann bleibt es schwer. Daher ist es so wichtig, dass man in der Tagessklinik in Gruppen über seine Probleme sprechen kann und dabei erfährt, dass es anderen Menschen ähnlich geht und was ihnen geholfen hat bzw. wie sie sich jeden Tag wieder motivieren, an ihrem Entschluss festzuhalten. Ganz wichtig ist hier, dass auch Peer-Berater*innen mit einbezogen werden, die als Role Models dienen können und anderen zeigen, welche Verhaltensänderungen ihnen geholfen haben, stabil zu werden und wie sie sich immer wieder überlisten, wenn es mal einfach sehr Schacher ist, sich an die guten Vorsätze zu halten. Es gibt sicher Verhaltensweisen, die man problemlos in den eigenen Lebensstil integrieren kann: Nicht in Discos gehen, nicht jeden Abend um die Häuser ziehen, früh schlafen gehen. Aber Essgewohnheiten ändern oder gar gegen die eigene Tabaksucht anzugehen ist schon deutlich schwieriger. Stress zu vermeiden ist besonders schwierig, weil man nicht immer sofort seinen eigene Lebenssituation verändern kann.
2. Emotional annehmen, dass eine Verhaltensänderung gut ist: Aber auch wenn ich verstanden habe, was nicht gut für mich ist, fällt es nicht unbedingt leicht, bestimmte Dinge zu lassen oder Dinge zu tun, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Erst wenn ich das auch emotional akzeptiert habe, kann ich mit den Veränderungen beginnen. Aber auch dann bleibt es schwer. Daher ist es so wichtig, dass man in der Tagessklinik in Gruppen über seine Probleme sprechen kann und dabei erfährt, dass es anderen Menschen ähnlich geht und was ihnen geholfen hat bzw. wie sie sich jeden Tag wieder motivieren, an ihrem Entschluss festzuhalten. Ganz wichtig ist hier, dass auch Peer-Berater*innen mit einbezogen werden, die als Role Models dienen können und anderen zeigen, welche Verhaltensänderungen ihnen geholfen haben, stabil zu werden und wie sie sich immer wieder überlisten, wenn es mal einfach sehr Schacher ist, sich an die guten Vorsätze zu halten. Es gibt sicher Verhaltensweisen, die man problemlos in den eigenen Lebensstil integrieren kann: Nicht in Discos gehen, nicht jeden Abend um die Häuser ziehen, früh schlafen gehen. Aber Essgewohnheiten ändern oder gar gegen die eigene Tabaksucht anzugehen ist schon deutlich schwieriger. Stress zu vermeiden ist besonders schwierig, weil man nicht immer sofort seinen eigene Lebenssituation verändern kann.
- Aus Büchern lernen
- Diskutieren
- Gedanken festhalten
- Von anderen lernen
- Ziele aufschreiben
3. Gute Didaktik: Nicht verordnen, dafür werben, Verständnis zeigen: Daher ist eine gute Didaktik so wichtig. Menschen sollte nicht vorgesetzt werden, das ist jetzt gut für Dich und wenn Du das nicht tust, bis Du selbst Schuld. Im Gegenteil, auch die Lehrenden sollten wissen oder zumindest Verständnis dafür haben, wie schwierig es ist, etwas im eigenen Leben zu verändern. Auch hier sind die Peers wieder so wichtig: Man lernt eher von Menschen, die das gleiche durchgemacht haben.
Ich möchte ein paar Beispiele geben: Natürlich ist es leicht zu verstehen, dass Bewegung besser ist, als den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und Fernsehen zu gucken. Aber niemand macht Sport, nur weil andere ihm erzählen, es mache Spaß! Ich trampele auf Wunsch meines Arztes jeden Tag mindestens 20 Minuten auf meinem Ergometer. Zumindest fast jeden Tag. Aber bislang wurde noch nicht ein einziges Glückshormon bei mir ausgeschüttet, obwohl uns das doch immer versprochen wird! Als Erstes sollte man versuchen, herauszufinden, warum jemand keinen Sport treibt.  Vielleicht passt eine bestimmte Sportart nicht zu dem Menschen? Ist jemand einfach zu müde durch die Medikamente, um Sport zu machen? Es kann auch eine Rolle spielen, dass jemand sehr zugenommen hat und sich schämt, in Sportkleidung anzutreten. Meine Tochter hat jahrelang professionell Fechtsport betrieben. Jetzt wagt sie sich nicht wieder, damit anzufangen. Ein junger Patient, der über 100 Kilo wog erzählte mir unglücklich, dass dort in der Klinik Tanztherapie angeboten würde. Aber als junger Mann wollte er mit seinem Gewicht nicht tanzen! Ganz wichtig sind auch Dozent*innen, die verstehen können, dass man nicht gerne Sport macht. Wenn mir ein begeisterter Sportler erzählt, dass er schon seit Jahren intensiv Sport betreibe und dass es herrlich sei, dann denke ich, klar, Dir macht das Spaß, mir aber nicht! Ich persönlich würde immer denken, jede Stunde Sport ist eine Stunde Lesen oder Schreiben weniger! Wenn aber jemand erzählt, dass er auch keinen Sport mochte, sich dann aber überwunden habe und mir dann auch noch erzählt, wie er es geschafft hat, sich zu überwinden, dann ist das eher eine Hilfe für mich.
Vielleicht passt eine bestimmte Sportart nicht zu dem Menschen? Ist jemand einfach zu müde durch die Medikamente, um Sport zu machen? Es kann auch eine Rolle spielen, dass jemand sehr zugenommen hat und sich schämt, in Sportkleidung anzutreten. Meine Tochter hat jahrelang professionell Fechtsport betrieben. Jetzt wagt sie sich nicht wieder, damit anzufangen. Ein junger Patient, der über 100 Kilo wog erzählte mir unglücklich, dass dort in der Klinik Tanztherapie angeboten würde. Aber als junger Mann wollte er mit seinem Gewicht nicht tanzen! Ganz wichtig sind auch Dozent*innen, die verstehen können, dass man nicht gerne Sport macht. Wenn mir ein begeisterter Sportler erzählt, dass er schon seit Jahren intensiv Sport betreibe und dass es herrlich sei, dann denke ich, klar, Dir macht das Spaß, mir aber nicht! Ich persönlich würde immer denken, jede Stunde Sport ist eine Stunde Lesen oder Schreiben weniger! Wenn aber jemand erzählt, dass er auch keinen Sport mochte, sich dann aber überwunden habe und mir dann auch noch erzählt, wie er es geschafft hat, sich zu überwinden, dann ist das eher eine Hilfe für mich.
- Klöße
- Feuerzeug
- Schweinshaxe
- Hamburger
Ähnlich ist es bei der Raucherentwöhnung: Wenn mir jemand erzählt, dass er noch nie geraucht hat und Zigarettenrauch widerlich findet, dann wird er mich kaum überzeugen. Nein, ein geläuterter Raucher kann das eher. In der Psychiatrischen Klinik in München gibt es inzwischen eine Tabakambulanz, in der Tabaksüchtige einen dreiwöchigen Kurs machen können. Zumindest hat man dort verstanden, dass es nicht getan ist mit dem Hinweis, dass Tabak ungesund sei! Um sich regelmäßigen Sofort anzugewöhnen, muss auch der richtige Sport gefunden werden: Die Initiative „Laufen für seelische Gesundheit“ ist großartig. Aber nicht für jeden ist Laufen das Richtige, man sollte die Betroffenen ermutigen, den richtigen Sport für sich zu finden. Auch gesünder zu essen ist ähnlich schwierig: Manchmal ist jemand einfach zu müde, um sich abends etwas zu kochen und hat nur noch die Kraft, ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu schieben. Oft sind gesunde Lebensmittel auch einfach teurer. Und manchmal schmeckt auch ein Teller Spaghetti Bolognese einfach besser als ein Teller geschabte Möhren mit Zitrone. Ich weiß, wovon ich spreche.
Es wäre besser, wenn jemand ehrlich sagt, Sport macht mir auch nicht immer Spaß, geschabte Möhrchen sind nicht mein Lieblingsgericht und ich sehne mich heute oft noch nach einer Zigarette. Aber ich habe verstanden und akzeptiert, dass das, was mir keinen Spaß macht, mir tatsächlich helfen kann, Krisen zu vermeiden. Vielleicht kommt der Spaß später.
Ein sehr schwieriges Kapitel ist es, Stress aus dem eigenen Leben fernzuhalten. Der Stress, den ich empfinde, ist ja nicht immer nur von mir selbst abhängig. Wie  schütze ich mich vor Situationen, die nicht gut für mich sind? Oder für Beziehungen, die negativen Stress bei mir hervorrufen? Kann ich einfach meinen Job kündigen, in eine neue Wohnung ziehen? Noch schwieriger ist es, sich vor Beziehungen im eigenen Leben zu schützen, die einfach nicht gut tun und Stress auslösen. Das ist nicht immer einfach. Kann ich mich von meinem Lebenspartner treffen? Kann ich lernen, mich gegenüber meinen Eltern selbstbewusster zu verhalten? Wie schaffe ich es, mich aus einer zu großen Nähe mit meinen Eltern zu befreien?
schütze ich mich vor Situationen, die nicht gut für mich sind? Oder für Beziehungen, die negativen Stress bei mir hervorrufen? Kann ich einfach meinen Job kündigen, in eine neue Wohnung ziehen? Noch schwieriger ist es, sich vor Beziehungen im eigenen Leben zu schützen, die einfach nicht gut tun und Stress auslösen. Das ist nicht immer einfach. Kann ich mich von meinem Lebenspartner treffen? Kann ich lernen, mich gegenüber meinen Eltern selbstbewusster zu verhalten? Wie schaffe ich es, mich aus einer zu großen Nähe mit meinen Eltern zu befreien?
4. Geduld und Redundanz: immer wieder erklären: Daher gehört zur Veränderung des eigenen Lebensstils auch sehr viel Zeit, Geduld und auch Redundanz. Man braucht immer wieder einen Anstoß, immer wieder einen Erinnerung und Ermutigung, bis man es allmählich schafft, den eigenen Lebensstil so anzupassen, dass er die Gefahr einer Krise möglichst verringert. Deshalb ist auch das Konzept der Tagesklinik Bipolar so wichtig: Bei allen diesen Themen wird hier anhaltend Unterstützung angeboten. In sechs Wochen kann sicher keine vollkommene Lebensstilveränderung erreicht werden, aber es können erste Impulse gesetzt werden: Es geht um Verständnis für die Krankheit, Möglichkeiten, das eigene Leben zu ändern. Diese Zeit kann helfen, ein erstes Verständnis dafür zu bekommen, wie man auch mit der Erkrankung ein gutes Leben führen kann.
- Fußball
- Yoga
- Schwimmen
- Fechten
- Inline Skating
Hochachtung vor allen Betroffenen: Uns allen fällt es schwer, unseren Lebensstil zu ändern, aber umso mehr muss es Menschen schwerfallen, bei denen in einer Manie die Gefühle außer Kontrolle geraten. Denen jede Aktivität in einer Depression wie dass Besteigen eines riesigen Berges erscheint oder die durch die Medikamente unendlich müde werden. Daher bewundere ich jeden Betroffenen, auch meine Tochter, dafür, wie tapfer und konsequent sie sich täglich bemühen, ihr Leben in den Griff zu bekommen und sich nicht von der Krankheit besiegen zu lassen.
Auch wir Angehörigen müssen uns ändern: Wir Angehörigen stehen vor einer ähnlich schweren Aufgabe: Auch wir müssen etwas ändern in unserem Leben. Vielleicht nicht so sehr unseren Lebensstil, aber unsere Einstellungen und unsere Gefühle. Wir müssen unsere Einstellung zu der Krankheit unseres Kindes ändern. Nein, eine psychische Erkrankung ist keine Katastrophe, es ist eine schwierige Situation, aber wir können lernen, damit zu leben. Das müssen unsere Kinder schließlich auch.  Wir müssen das, obwohl oft unser ganzes Leben, unsere Wünsche, unsere Erwartungen mit dem Auftreten der Krankheit aus den Fugen geraten ist. Wir müssen die Realität akzeptieren: Unser Leben und das unseres Kindes wird anders sein, als wir es uns für es und für uns gewünscht haben, aber es kann dennoch ein gutes Leben sein. Das klingt vernünftig, ist aber nicht leicht emotional umzusetzen. Wir müssen unsere Copingstrategien ändern: Lernen loszulassen, obwohl wir nicht wissen, wie wir mit unserer Angst umgehen sollen. Aufhören, uns unentwegt Sorgen zu machen, weil das zu einer Belastung für unsere Kinder wird und auch uns krank machen kann. Wir sollten Grenzen setzen, obwohl wir ständig darüber nachdenken, ob das nicht eine Gefahr für den Betroffenen bedeutet. Keine Angehörige schafft das von einem Tag auf den anderen, es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Ich weiß, wovon ich spreche. Auch wir Angehörige brauchen Geduld und Verständnis. Was wir leider nicht immer bekommen! Ich selbst werde inzwischen als sehr gelassene Angehörige bezeichnet. Das bin ich auch, bis zu dem Moment, in dem meine Tochter mich drei Tage nicht angerufen hat! Ich freue mich daher, dass es in der Tagesklinik auch Angebote für Angehörige gibt. Ein Angebot wie dieses hier in der Tagesklinik hätte mir und Henriette vor 23 Jahren sicher sehr viel Kummer und Schwierigkeiten erspart.
Wir müssen das, obwohl oft unser ganzes Leben, unsere Wünsche, unsere Erwartungen mit dem Auftreten der Krankheit aus den Fugen geraten ist. Wir müssen die Realität akzeptieren: Unser Leben und das unseres Kindes wird anders sein, als wir es uns für es und für uns gewünscht haben, aber es kann dennoch ein gutes Leben sein. Das klingt vernünftig, ist aber nicht leicht emotional umzusetzen. Wir müssen unsere Copingstrategien ändern: Lernen loszulassen, obwohl wir nicht wissen, wie wir mit unserer Angst umgehen sollen. Aufhören, uns unentwegt Sorgen zu machen, weil das zu einer Belastung für unsere Kinder wird und auch uns krank machen kann. Wir sollten Grenzen setzen, obwohl wir ständig darüber nachdenken, ob das nicht eine Gefahr für den Betroffenen bedeutet. Keine Angehörige schafft das von einem Tag auf den anderen, es wird ein lebenslanger Prozess bleiben. Ich weiß, wovon ich spreche. Auch wir Angehörige brauchen Geduld und Verständnis. Was wir leider nicht immer bekommen! Ich selbst werde inzwischen als sehr gelassene Angehörige bezeichnet. Das bin ich auch, bis zu dem Moment, in dem meine Tochter mich drei Tage nicht angerufen hat! Ich freue mich daher, dass es in der Tagesklinik auch Angebote für Angehörige gibt. Ein Angebot wie dieses hier in der Tagesklinik hätte mir und Henriette vor 23 Jahren sicher sehr viel Kummer und Schwierigkeiten erspart.
- Blumenfreude
- Spaghetti Bolognese
- Espresso geht zum Webinar
- Rote Bücher
- Lavendel
Ein letzter, aber wichtiger Appell: Wer ist nicht schafft, ist nicht selbst schuld! Alle Angebote zur Lebensstiländerung sind gut und wichtig. Aber eines darf nicht passieren: Keinem Betroffenen darf es jemals angelastet werden, wenn er es nicht „schafft“ oder nicht immer schafft. Vielleicht ist die Lebenssituation zu ungünstig, vielleicht ist die Krankheit zu schwer. Henriette hat mir auch gesagt, dass es in schlechteren Zeiten manchmal für sie wichtiger ist, ein Stück Lebensfreude – von ihr aus auch mit ungesundem Essen – zurück ins eigene Leben zu holen. Aber es darf niemals gesagt werden: Du bist selbst schuld an der erneuten Krise, wenn Du Deinen Lebensstil einfach nicht änderst.
Bis bald. So viel zur Gesundheit. Das esse ich gern!

Spaghetti Bolognese